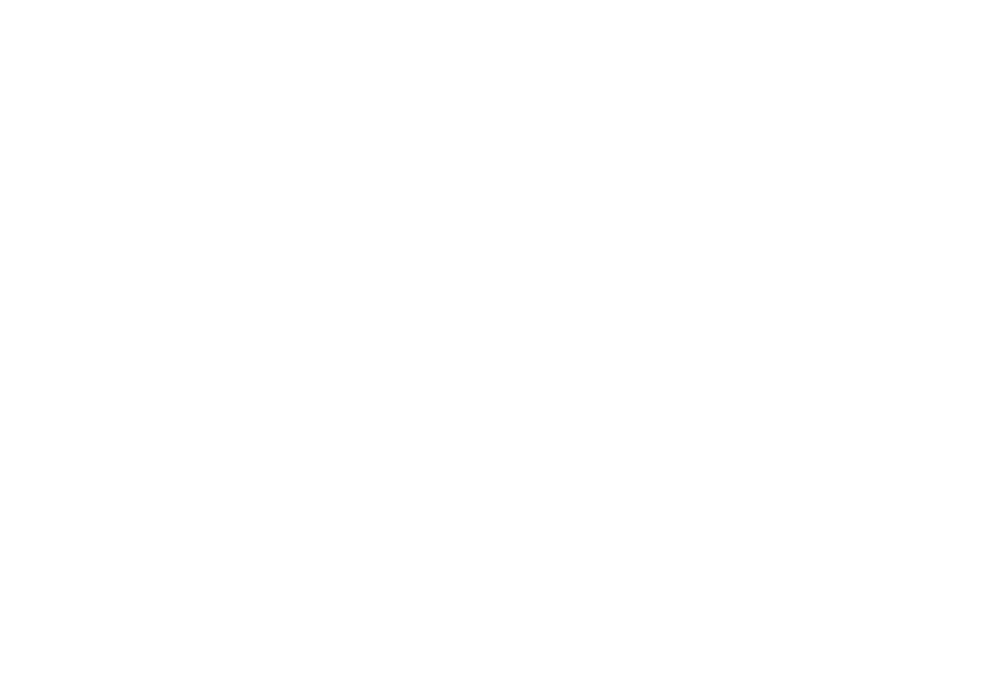
| Kurzgeschichte |
Auf der Spur des Schweigens |
Die Erinnerung ist schon sehr verblasst. Die Bilder aber stehen deutlich vor meinem inneren Auge, als hätte ich das alles gestern erst erlebt – wie vergilbte Fotos aus der Zeit, schwarz-weiß, oder besser grau in grau. Grau wie der Asphalt der breiten Straße, in der wir kämpften, grau, wie unsere Mäntel, wie die Fassaden der zerschossenen Häuser, wie die Sandsäcke, hinter denen sich die Franzosen verschanzt hatten.
Am frühen Morgen waren wir auf diese kleine Einheit gestoßen und versuchten seitdem, ihre Stellung einzunehmen. Seit Stunden jedoch tat sich nichts mehr, außer gelegentlichen Schusswechseln, wenn wieder einer so unvorsichtig gewesen war, ein Stück aus seiner Deckung zu treten. Auf unserer Seite führten die Schüsse aber kaum zu Verlusten, bei unseren Gegnern vermutlich ebenso wenig. Wir warteten. Beide Seiten warteten, dass die andere Seite die Nerven verlieren würde und entweder angriff oder abrückte.
Nach einiger Zeit fiel mir eine Gewehrmündung bei den Franzosen auf, die besonders scharf zu schießen schien. Bei jedem der seltenen Schüsse aus diesem Lauf war in unserem Lager große Aufregung. Ich konnte nicht immer sehen, ob jemand von uns getroffen war, aber vermutlich gingen einige unserer Toten auf Kosten dieser Waffe.
In meiner Abteilung war ich immer als der beste Schütze bekannt, und so sah ich es als meine Aufgabe an, diese Gefahr zu beseitigen. Das Gewehr lugte aus einer kleinen Lücke zwischen den Sandsäcken hervor, ebenso wie meines, und es schien sich langsam zu mir vorzuarbeiten, denn nach jedem Schuss zielte es ein Stück näher in meine Richtung. Schon deshalb wollte ich diesem Übel schnell ein Ende bereiten. Einen Schützen, oder auch nur einen Teil von ihm, konnte ich zu keinem Zeitpunkt erkennen, doch es musste reichen, mit einem Schuss in die besagte Lücke zu treffen. Ich beobachtete meinen privaten Gegner noch eine Weile, dann legte ich an. Doch im selben Moment drehte er sein Gewehr und visierte mich an. Reflexartig warf ich mich zur Seite, zog mein Gewehr zurück und lehnte mich mit dem Rücken gegen unsere Barrikade.
Sollte er schneller sein als ich? Würde er mich erwischen, und nicht ich ihn? Ich spürte wieder diesen alten Wunsch in mir, wegzulaufen, und nur mein kleines, nacktes Leben zu retten, und ihm von mir aus seines zu lassen. Ich saß eine Weile reglos da, dachte an meine Kameraden, die er schon erwischt hatte, und entschied mich dafür, es ihm nicht zu lassen.
Sekunden später sah ich wieder durch mein Loch zur Außenwelt. Die Gelegenheit war günstig, denn wie ich deutlich erkennen konnte, hatte er sich ein anderes Ziel gesucht. Ich schob mein Gewehr vor und zielte.
Ich muss besonders lange gezielt haben, denn bevor ich meinen tödlichen Schuss an den Mann bringen konnte, sah ich etwas, das mich völlig aus der Fassung brachte: einen Hund. Da lief tatsächlich ein Hund quer über die Straße. Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein, und deshalb kniff ich meine Augen zu. Doch als ich sie wieder öffnete, stand er inzwischen direkt zwischen mir und meinem Franzosen. Wo kam dieser Hund her? Wieso gab es hier noch andere Lebewesen außer uns, die wir hier sein mussten? Die Zivilisten waren alle geflohen. Dieser Hund musste vergessen worden sein. Und jetzt stand er hier, wühlte in den Trümmern des Krieges und schien sich an der Schießerei nicht zu stören. War er taub? War er nur ein Geist? War ich gerade dabei, den Verstand zu verlieren?
Er stand einfach da, störte sich nicht an uns, aber störte uns bei unserer Arbeit, störte mich dabei, meine Kameraden zu beschützen. Er gehörte nicht hierher. Hier war kein Platz für ihn. Hier hatte er keine Überlebenschance. Er versperrte die Sicht auf das Gegenüber. Er musste weg, und so zielte ich auf ihn. Armer, unschuldiger Hund, dachte ich. Aber schließlich war es so etwas wie Notwehr, denn ich brauchte doch die Sicht nach drüben.
Eine Sekunde, bevor ich abdrückte, ging er ein paar Zentimeter weiter nach vorne, und einen Bruchteil einer Sekunde vor meinem Schuss sah ich das Mündungsfeuer auf der anderen Seite.
Ich saß eine ganze Weile mit dem Rücken an der Barrikade und beobachtete den Rauch, der langsam aus meinem Gewehr aufstieg. Den Hund hatte ich noch fallen sehen, auch, wie das andere Gewehr in seinem Loch verschwunden war. Jetzt saß ich hier, und traute mich nicht hinaus zu blicken.
Hatten wir beide den Hund erschossen? Uns beiden war er im Weg gewesen, und jetzt lag er tot da draußen. Warum hatten wir nicht eine Sekunde warten können, dann hätten wir wieder freie Schusslinie aufeinander gehabt. Aber dann hätten ihn andere erschossen. Und wenn nicht, dann wäre er hier verhungert mit der Zeit. So haben wir ihm also zu einem schnellen, gnädigen Tod verholfen. Außerdem hatte der Franzose zuerst geschossen!
Langsam verdrängte ich den Schrecken und lugte vorsichtig hinaus. Mein gegnerisches Gewehr sah ich nicht. Den Hund konnte ich auch nicht sehen zwischen dem Schutt. Aber was ich dann sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Es war wie im Traum. Alles schien in Zeitlupe zu geschehen. Wie gebannt starrte ich auf das, was da draußen vor sich ging. Ein kleines Mädchen in einem bunten Kleid lief über die Straße bis zu der Stelle, wo der Hund liegen musste. Dort blieb es eine Weile stehen und schaute hinab. Dann kniete es nieder und beugte sich nach vorn. Kurz darauf kam eine junge Frau zu dem Mädchen gelaufen, hockte sich neben sie und nahm sie in den Arm.
Es war gespenstisch. Mitten im Krieg knieten eine Frau und ein Kind auf dem Schlachtfeld. Dort zwischen den Fronten scherten sie sich nicht darum, dass sie zahllose Schusslinien zerschnitten. Keine Seite würdigten sie eines Blickes. Sie hockten nur da und kümmerten sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Sie waren dort und blieben dort. Sie hatten keine Eile und zeigten weder Angst noch Wut. Niemanden klagten sie an, niemanden ließen sie überhaupt teilhaben an ihrer kleinen Welt. Unbarmherzig ignorierten sie das gesamte übrige Universum mit all seinen Göttern und Menschen. Für mich, der ich diese unwirkliche Szene aus halber Schussweite betrachtete, war es wie ein Schlag mitten ins Gesicht, gleich einer Strafe dafür, dass ich hier war. Nie in meinem langen Leben empfand ich größere Scham.
Als – es muss gegen Ende aller Zeiten gewesen sein – der richtige Moment gekommen war, standen beide auf. Ich sah, wie die junge Frau den Kadaver auf ihrem Arm trug. Gemeinsam machten Frau und Kind nun kehrt und gingen so langsam wie bei einer Prozession zurück zur Häuserzeile und verschwanden dort durch einen großen Torbogen.
Bis heute weiß ich nicht, ob während dieser endlosen Zeit weiter geschossen wurde oder nicht. Nichts um mich herum habe ich wahrgenommen, als sich diese unheimliche Szene vor meinen Augen abspielte. Und bis heute weiß ich nicht, ob meine Kameraden dasselbe gesehen haben wie ich. Nie hat einer von ihnen ein Wort darüber verloren, und auch ich habe es niemals angesprochen. Doch dieses Erlebnis blieb in mir, es hat mich beschäftigt, es hat mich gequält, manchmal war es mir egal, aber es kam immer wieder, es war einfach da.
–
Dreiundvierzig Jahre später bin ich jetzt erneut in der Stadt, um mir alles noch einmal vor Ort ansehen. Ich muss einige Zeit suchen, bis ich die Straße wiederfinde. Und als ich dann an der Stelle stehe, an der ich damals lag, bin ich enttäuscht, denn die Flut der Erinnerungen bleibt aus. Alles hat sich so sehr verändert. Einige Häuser sind neu gebaut worden, manche erst in jüngster Zeit. Eine Straße voller Leben liegt vor mir, eine Fußgängerzone mit einem kleinen Brunnen in der Mitte, ungefähr dort, wo der Hund gestorben ist. Weiter die Straße hinab kann ich die Kreuzung sehen, an der sich damals die Franzosen verschanzt haben.
Ich gehe zu dem Brunnen und setze mich zu einem älteren Mann auf eine Bank. Von hier aus kann ich auf das Haus sehen, in dem damals die Frau und das Mädchen verschwunden sind. Es gibt keinen Zweifel, dass es das Haus ist, denn es hat als einziges einen runden Torbogen, wie es auch vor dreiundvierzig Jahren das einzige mit einem runden Torbogen gewesen ist. Ich betrachte es lange. Wer hat in dem Haus gelebt? Wer damals, und wer heute? Was ist aus der jungen Frau geworden? Wohnt sie noch hier? Und wohnt das Mädchen noch hier? Es muss inzwischen um die fünfzig sein. Ich schaue mich um. Jede der Frauen in diesem Alter könnte dieses Mädchen sein.
Den ganzen Nachmittag über sitze ich auf dieser Bank, in der Hoffnung, wenigstens einen der Hausbewohner zu sehen. Doch niemand verlässt in dieser Zeit das Gebäude oder geht hinein. Ich frage den Mann neben mir, ob er wisse, wer darin wohnt. Doch ich spreche leider kein Französisch und er versteht kein Deutsch. Aber er bietet mir einen seiner Kekse an, die er mitgebracht hat.
So sitze ich noch eine ganze Weile und starre auf das Haus. Erst als die Sonne langsam untergeht, stehe ich auf und gehe wieder die Straße hinauf. Dort, wo ich vor dreiundvierzig Jahren gelegen habe, schaue ich mich noch einmal um. Die Bank ist inzwischen leer und ich sehe noch den alten Mann die Straße hinunter gehen.
| (c) www.coonlight.de |
| geschrieben 1998 |
Schreibe hier den ersten Kommentar:
„Patsch!“, rief Edmund, als wieder ein fettes Insekt auf der Windschutzscheibe zerplatzte. Der Scheibenwischer schmierte einen besonders unschönen Streifen über das Glas, und aus den Wischwasserdüsen sprudelten nur noch kleine Bläschen. Edmund fluchte. Nach nunmehr dreihundertfünfzig Autobahnkilometern wurde ihm die ganze Sache jetzt eigentlich zu undurchsichtig, doch er war spät dran. Die vom Navi prophezeite Ankunftszeit ließ keinen großen Spielraum mehr. Dieser Druck saß ihm im Nacken und pflanzte sich fort bis zum Gaspedal. „Fahr lieber etwas langsamer, dann kommst du schneller an“, war eigentlich sein Wahlspruch, doch heute musste er ihn verdrängen so gut er konnte.









